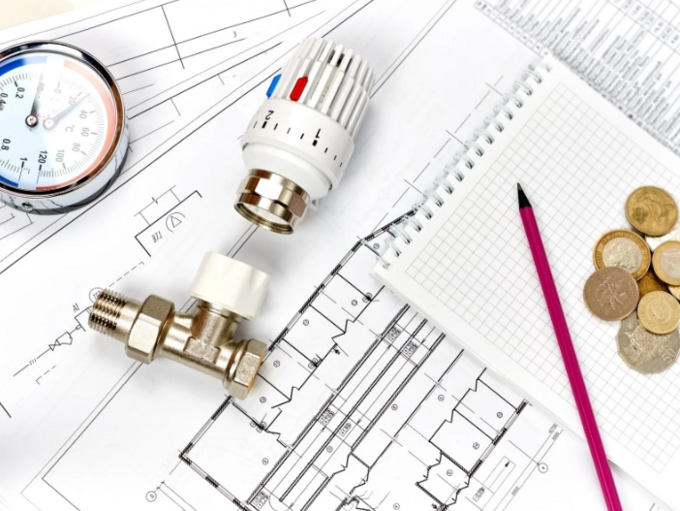Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen ihre Wärmepläne bis Ende Juni 2026 einreichen. Diese Pläne umfassen unter anderem, wo Fernwärmeversorgung vorgesehen ist oder wo ein Wasserstoffnetz entstehen soll. Kleinere Städte und Gemeinden haben hingegen bis Ende Juni 2028 Zeit. Diese Pläne sollen Investitions- und Planungssicherheit für Gebäudeeigentümer, Unternehmen und die zuständigen Stellen schaffen.
Die kommunale Wärmeplanung ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Klimapolitik. Sie verpflichtet die Kommunen, Pläne zu entwickeln, die festlegen, welche Technologien und Energieträger in ihrer Region genutzt werden sollen. Künftig sollen dabei fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
Das Wärmeplanungsgesetz bildet auch die Grundlage für das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das den Einsatz erneuerbarer Energien beim Heizen fördern soll. Strengere Vorschriften für den Einbau neuer Heizungen in Bestandsgebäuden treten erst in Kraft, wenn ein kommunaler Wärmeplan vorliegt und die anschließende Gebietsausweisung beschlossen ist. Dann müssen auch in Bestandsgebäuden Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Diese Regelung galt zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten.